Nordhausen, StadtLandMobilität
Emissionsfrei und neu vertaktet
Wie organisiert man eine nachhaltige Mobilität für Stadt und Land? Den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) langfristig kostendeckender zu betreiben, im ländlichen Raum attraktiver zu machen und ressourcenschonend auszubauen sind Ziele, die deutschlandweit unter intensiven Debatten verfolgt werden. Neben den Zielen einer besseren Erreichbarkeit des ländlichen Raumes gilt es aber auch, die Klimabilanz zu verbessern: Gut ein Viertel der CO2-Emissionen in der Stadt Nordhausen und im Landkreis verursacht der Mobilitätssektor. Den Nordhäuser:innen ist zudem der Erhalt ihrer 100-jährigen Straßenbahn wichtig. Um dies alles zu ermöglichen, setzen Stadt und Landkreis gemeinsam auf ein integriertes StadtLand-Mobilitätskonzept. Es versucht, ökologisch sinnvolle und sozial gerechte Lösungen für einen klimafreundlichen Verkehr zu finden. Das übergeordnete Ziel ist dabei die emissionsfreie Mobilität bis 2040. Vorrang aller zukünftigen Investitionen in Stadt und Landkreis haben gleichermaßen der Ausbau des ÖPNV, des Fuß- und Radverkehrs.
Eine kooperative Arbeitsweise ist hier in mehrfacher Hinsicht Basis der Zukunftsentwicklungen. Seit den Bürgerwerkstätten 2015 zur Entwicklung der Klimaregion Nordhausen wurden alternative Finanzierungsmöglichkeiten des ÖPNV und eine ÖPNV-Flatrate thematisiert, erste Busse auf elektrischen Antrieb umgestellt, das E-Ticketing vorbereitet und durch den lokalen Energieversorger der Ausbau der E-Ladeinfrastruktur vorangetrieben. Darauf aufbauend startete Ende 2020 die gemeinsame Erarbeitung des integrierten Mobilitätskonzepts für die Stadt und den Landkreis Nordhausen. Vertreter:innen von Verbänden und Verwaltung sowie aus der Politik trugen dabei erstmals ihre Erkenntnisse zusammen, wie die Verkehrsströme insgesamt nachhaltiger gestaltet werden können; Bürgerinterventionen erprobten erste Maßnahmen wie das 1-Euro-Ticket oder das Anradeln. Die team red Deutschland GmbH erarbeitete daraufhin das integrierte StadtLand-Mobilitätskonzept. Dazu wurden die räumlichen Leitbilder »10-Minuten-Stadt« und »30-Minuten-Landkreis« entwickelt. Innerhalb dieser Zeitradien sollen alle lebensrelevanten Einrichtungen auf dem kürzesten Weg zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Bus und Bahn erreichbar sein. Die zukünftige Siedlungsentwicklung könnte so auf Grundlage einer CO2-neutralen Mobilitätsstruktur erfolgen.
So unprätentiös der Ansatz auch klingt, stellt das Konzept eine radikale Umkehr der Planung dar, in der häufig die Verkehrsplanung vor vollendeten Tatsachen steht. Vielmehr wird nun die Raumentwicklung aus Sicht der klimagerechten Erreichbarkeit weitergedacht. In Gebieten jenseits der Siedlungsschwerpunkte und -achsen wird ein gutes ÖPNV-Angebot und ein dichtes Rad- bzw. Fußwegenetz jedoch schwer zu realisieren sein. Daher liegt der Fokus hier auf Systemen, die den sozialen Zusammenhalt in den Regionen stärken wie Mitfahrbänke, neue Pendlerportale oder nachbarschaftliches Carsharing. Als gewerbliche Dienstleistungen können On-Demand-Verkehre das ÖPNV-Angebot ergänzen und mit den Angeboten entlang der Achsen verknüpfen. In stark peripheren Siedlungsstrukturen übernimmt weiterhin der private Pkw eine zentrale Rolle. Um aber auch hier den Transfer zu einer emissionsfreien Mobilität zu ermöglichen, ist zu den privaten E-Lademöglichkeiten ein Angebot an (halb-)öffentlichen E-Ladesäulen in Zusammenarbeit mit lokalen Dienstleister:innen und Gewerbetreibenden nötig.
Das Konzept der 10- bzw. 15-Minuten-Stadt ist nicht neu, es gibt das Prinzip der kurzen Wege schon länger, in größeren Städten ist das Angebot innerstädtisch ohnehin recht dicht. Aber wie sieht die Umsetzung jenseits davon aus? Genau hier setzt das Mobilitätskonzept in Stadt und Landkreis Nordhausen an. Maßnahmenvorschläge zur Umsetzung sind neben der Siedlungsentwicklung ein durchgängig ausgebautes Radverkehrsnetz mit Abstell- und Mitnahmemöglichkeiten bei Anschlussverkehren, eine smarte digitale und analoge Vernetzung von Angeboten der Bahn, von Bus, (E-)Bikes und Sharing-Angeboten, die Beschleunigung des ÖPNV durch Vorrang im Verkehr, die dichtere Vertaktung des ÖPNV — innerstädtisch alle 10, außerhalb alle 20 Minuten und peripher mindestens stündlich —, die Reduzierung von Höchstgeschwindigkeiten sowie über 40 weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Fuß-, Rad- und ÖPNV-Entwicklung. Dank des 49-Euro-Tickets wird der öffentliche Nahverkehr bezahlbar bleiben und kann um weitere Abomodelle zum Beispiel in Kombination mit Sharingsystemen oder Mietmodellen ergänzt werden. Neben dem räumlichen Leitbild wurden jedoch auch quantitative Ziele definiert: Der Anteil des privaten Pkw-Verkehrs soll bis 2040 in Stadt und Landkreis halbiert werden, der Rad- und ÖPNV-Anteil sich mehr als verdoppeln und gegenüber heute ein Drittel mehr Menschen zu Fuß im Landkreis unterwegs sein. Diesen Zielen liegt eine fraktionsübergreifende Abstimmung in einer gemeinsamen Ausschusssitzung von Stadt und Landkreis zu Grunde. Ein zukünftig regelmäßiges Monitoring wird helfen, die Zielerreichung zu messen.
Die Partner:innen sind sich einig, dass Maßnahmen wie die E-Auto-Prämie nicht ausreichen, um klimagerechter zu agieren. Vielmehr müssen sich Mobilitätsgewohnheiten ändern. Dazu muss die Welt nicht neu erfunden, sondern nur multifunktionaler weiterentwickelt, Angebote zurück in die Orte verlagert und wieder zu mehr Freude an der Bewegung beim Fuß- und Radverkehr motiviert werden. Das Mobilitätskonzept benennt hierzu schnell umzusetzende Maßnahmen ab 2023: Nach dem Prinzip »jede Straßenlaterne eine Haltestelle« werden virtuelle Busstopps zur Individualisierung des ÖPNVs erprobt, (öffentliche) Pkw-Stellplätze in Wohngebieten beispielhaft zu überdachten und abschließbaren Radabstellanlagen umgebaut, die Einführung von Carsharing-Angeboten in den kommunalen Verwaltungen geplant, die Installation mindestens einer Mitnahmebank je Ortsteil umgesetzt sowie die Einführung einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Kilometer pro Stunde auf allen verkehrsrechtlich möglichen Straßen in Stadt und Landkreis geprüft. Ein:e neue:r Mobilitätsmanager:in soll künftig die integrierte Mobilität koordinieren.
Klimaregion Nordhausen im IBA Finale 2023
Die vierte Etappe der finalen IBA Tour führte den Fachbeirat und das Team der IBA Thüringen am 1. März 2023 nach Nordhausen. Dort überreichte die IBA Geschäftsführerin Marta Doehler-Behzadi den Projektträger:innen Stadt Nordhausen, der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft mbH (SWG) Nordhausen, der Hochschule Nordhausen, dem Kooperationspartner Landkreis Nordhausen sowie den Planungsbeteiligten Urkunden zur Aufnahme in die IBA Abschlusspräsentation. Dieser symbolische Akt ist die finale Auszeichnung, welche ein IBA Vorhaben im Rahmen der IBA Thüringen erreichen kann.
Mitmach-Initiativen zum Themenschwerpunkt Radverkehr durchgeführt
Am Samstag, 14. Mai 2022, startete der zweite Teil des Integrierten Mobilitätskonzepts für die Stadt und den Landkreis Nordhausen. Bei den einzelnen Themenblöcken waren die Bewohner:innen aufgerufen, ihre Meinungen und Anregungen im Rahmen von Bürgerbeteiligungsprozessen aufzuzeigen. Nach dem Thema
›ÖPNV‹ im Herbst 2021, drehte sich zwischen Mai und Juni 2022 alles um das Thema Radverkehr. Die Nordhäuser:innen wurden mit verschiedenen Aktionen aufgerufen, über die Stärken und Schwächen sowie die eigenen Wünsche und Möglichkeiten für die Zukunft des Radverkehrs im Stadtgebiet Nordhausen offen zu diskutieren. Den Start hierzu bildete ein moderierte Workshop am Samstag im Ratssaal des Nordhäuser Bürgerhauses. Die Ergebnisse wurden protokolliert und werden am Ende in das Integrierte Mobilitätskonzept für eine stadt- und landkreisverträgliche Mobilität einfließen.
Direkt im Anschluss an den Workshop startete die Mitmach-Initiative ›Anradeln‹, die bis zum 3. Juni durchgeführt wurde: auf der Internetseite ›Nordhausen bewegt sich!‹ konnten Nordhäuserinnen und Nordhäuser in diesem Zeitraum geplanten Radfahrten mit Daten, Uhrzeiten und Strecken eintragen und so Mitradler:innen finden. Vorteile des gemeinsamen Radelns waren mehr Sichtbarkeit und Sicherheit im Verkehr, der Austausch von Wissen zu Strecken und Radtechnik sowie die Vernetzung untereinander. So konnten sich im Rahmen der Aktion Gleichgesinnte für das Freizeitradeln oder den gemeinsamen Weg zur Arbeit, Hochschule oder Schule finden. Gleichzeitig bot ein Ideenmelder auf der Internetseite die Möglichkeit, bei Bedarf Rückmeldungen zur Radinfrastruktur in Stadt und Landkreis zu geben, um so Ansatzpunkte für Verbesserungen aufzuzeigen.
Der Schwung, der während der Aktion ›Anradeln‹ entstanden ist, wurde beim anschließenden ›Stadtradeln‹ aufgegriffen. Zum fünften Mal in Folge und erstmalig gemeinsam nahmen die Stadt und der Landkreis Nordhausen vom 4. bis 24. Juni am ›Stadtradeln‹ teil und versuchten in drei Wochen so viele Wege und Strecken wie möglich klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen.
Weitere Informationen zum Vorhaben, zum Thema Mobilität und den durchgeführten Interventionen finden Sie auf der Projektwebseite ›Nordhausen bewegt sich!‹

© Stadt Nordhausen
Weiter GEHT es: Interventionen dem Thema Fußverkehr in Nordhausen
Während für das integrierte Mobilitätskonzept für Stadt und Landkreis Nordhausen der Fokus im Mai und Juni auf den Radverkehr gelegt wurde, starteten im Juni parallel Aktionen zum Themenschwerpunkt Fußverkehr.
Bei einem Workshop am 16. Juni drehte sich alles um diejenigen, die zu Fuß unterwegs sind. In eine gemeinsamen Diskussion mit den Nordhäuserinnen und Nordhäusern wurden gemeinsam Ideen entwickelt, um das Gehen, Laufen, Spazieren und Wandern in Stadt und Landkreis Nordhausen attraktiver zu gestalten. Zusätzlich fanden am 16. und 17. Juni vier thematische Checks des Fußverkehrs in der Region statt, um konkret vor Ort nach Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen.
Die Ergebnisse aus dem Workshop und den Fußverkehrchecks werden in die Entwicklung des Integrierten Mobilitätskonzepts einfließen, an dem die Stadt und der Landkreis Nordhausen derzeit gemeinsam mit der IBA Thüringen und dem Beratungsteam team red Deutschland arbeiten. Ziel des Konzeptes ist die zukunftsfähige und attraktive Gestaltung der Mobilität für Stadt und Landkreis. Als Basis dient hierfür der Dialog mit den Einwohner:innen. Ihre Bedürfnisse und Wünsche sollen in konkrete Maßnahmen umgesetzt werden. Eine generelle Übersicht zum Konzept der Integrierten Mobilität und den geplanten Projekten findet Sie unter www.ndhbewegtsich.de

© Stadt Nordhausen
Nordhausen beweget sich!
Umweltfreundlich, nachhaltig, erreichbar und finanzierbar – so soll der Verkehr der Zukunft in und um die Stadt und den Landkreis Nordhausen aussehen. Bis Ende 2022 wird dazu ein Integriertes Mobilitätskonzept gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen team red Deutschland GmbH erarbeitet.
In einem ersten Workshop wurde die weitere strategische Ausrichtung des Mobilitätskonzeptes bestimmt und eine Analyse der Verkehrsnetze inklusive öffentlichem Mängelmelder für die Bevölkerung durchgeführt. Im September startete die erste von drei Runden der partizipativen Werkstätten und Interventionen zum Thema klimagerechte Mobilität. Los ging es mit dem Thema ›Öffentlicher Personenennahverkehr (ÖPNV)‹ – also in Nordhausen und Region vor allem dem Busfahren: Vom 13. bis 17. September 2021 boten die Verkehrsbetriebe Nordhausen einen erweiterten Fahrplan, der im Zeitraum der Aktionswoche zum Fahrpreis von 1 Euro genutzt werden konnte. Feedback, Ideen und Wünsche zum ÖPNV wurden abschließend am 16. September 2021 während der ›Bus-Gespräche‹ in Bleicherode, Heringen/Helme und Nordhausen eingeholt. Die Erkenntnisse aus den Gesprächen sowie die Auswertung der Nutzung des ÖPNV während der Mobilitätswoche fließen in das Mobilitätskonzept ein.
Weitere Informationen zum Vorhaben, zum Thema Mobilität und den geplanten Interventionen finden Sie auf der Projektwebseite ›Nordhausen bewegt sich!‹

Feedback, Ideen und Wünsche zum ÖPNV rund um Stadt und Landkreis Nordhausen waren Ziel der ›Bus-Gespräche‹.
Erarbeitung des integrierten Mobilitätskonzepts startet
Mit einem virtuellen Workshop startet in dieser Woche die Erarbeitung des integrierten Mobilitätskonzepts für die kreisangehörige Stadt Nordhausen und den Landkreis Nordhausen. Vertreter:innen von Verbänden und Verwaltung sowie aus der Politik tragen dabei erstmals ihre Erkenntnisse zusammen, wie die Verkehrsströme insgesamt nachhaltiger gestaltet werden können. Die Innovationsagentur team red Deutschland GmbH erarbeitet das Mobilitätskonzept im Auftrag von Stadtverwaltung und Landkreisverwaltung.
In Arbeitsgruppen wollen die Teilnehmer:innen verschiedene Aspekte des Verkehrs in der Stadt sowie im Landkreis diskutieren, beispielsweise in Bezug auf Wirtschaft und Tourismus sowie Stadt- und Regionalentwicklung. Im nächsten Jahr sind zudem mehrere Bürger:innenforen geplant, um die Interessen und Bedürfnisse der Einwohner:innen einzubeziehen. Bis Ende 2021 wird mit Unterstützung der IBA Thüringen das integrierte Mobilitätskonzept erarbeitet. Geplant ist darüber hinaus die Umsetzung erster Aktionen, um die Verkehrsbelastung in Stadt und Landkreis zu verringern.
Hintergrund:
Ziel des Konzepts ist es, die örtlichen Verkehrsbedarfe, -flüsse und -ziele zu überprüfen. Aufgrund der intensiven verkehrlichen Verflechtungen des Verkehrs in der Stadt Nordhausen mit dem Verkehr im ländlichen Raum, die sich beispielsweise aus den Pendlerbeziehungen sowie den gemeinsamen Nahverkehrsplan für den ÖPNV ergeben, ist eine gemeinsame Konzepterarbeitung wichtig. Das Mobilitätskonzept ist zudem ein Teil der Maßnahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes 2030 und des Integrierten Klimaschutzkonzeptes 2050 der Stadt Nordhausen. Das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft fördert das Vorhaben von Stadt und Landkreis Nordhausen. In Kooperation mit der Internationalen Bauausstellung Thüringen wird die Erarbeitung des Konzepts federführend durch die Stadt Nordhausen begleitet.
Abschlussforum zur ›Zukunftsstadt Nordhausen‹
Mit reger Beteiligung fand am Montag, dem 14. März 2016, in Nordhausen die Abschlussveranstaltung zur ersten Phase des Wettbewerbs ›Zukunftsstadt 2030+‹ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung statt.
Erneut fanden sich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger dafür im Bürgerhaus ein und diskutierten zwei Stunden intensiv die Kernthemen der vorangegangenen drei Bürgerwerkstätten. Erfreut über das Interesse und die große Zahl an neugierigen Bürger:innen zeigten sich neben den anwesenden Vertreter:innen der Stadtverwaltung, der IBA Thüringen und den Moderator:innen vom Planungsbüro StadtLabor aus Leipzig auch Oberbürgermeister Dr. Zeh, der das Grußwort hielt, sowie Prof. Dr. Wagner, Rektor der Hochschule Nordhausen, der mit seinen abschließenden Worten den Abend beendete.

Die an diesem Abend gebildete Redaktionsgruppe aus Bürger:innen und Verwaltung kümmerte sich um die Gestaltung der Zukunftszeitung für Nordhausen und um die Formulierung des Abschlussberichts (siehe Links/Material).
Die an diesem Abend gebildete Redaktionsgruppe aus Bürgern und Verwaltung wird sich nun um die Gestaltung einer Zukunftszeitung und um die Formulierung des Abschlussberichts kümmern. Beide Teile bilden zusammen mit dem ›Zukunftsbild-Nordhausen‹ den Wettbewerbsbeitrag, den Nordhausen beim Bundesministerium für Bildung und Forschung im Sommer einreichen wird. Die Jury des Ministeriums wird anschließend die 20 vielversprechendsten Beiträge aus den 51 Teilnehmerstädten auswählen, welche dann die Förderung für die zweite Phase des Wettbewerbs erhalten.
Bürgerwerkstätten für Zukunftsstadt
Foodsharing in Nordhausen? Ein Solarkataster für Bürgerenergie-Initiativen? Ein Flashmob zum Thema Energie sparen? Am 25. November 2015 lud die Stadt Nordhausen in Kooperation mit der Hochschule Nordhausen und der IBA Thüringen wieder in das Bürgerhaus in Nordhausen ein. Rund 70 Interessierte aus Stadt und Land läuteten gemeinsam die erste Runde von insgesamt drei Werkstattgesprächen im Rahmen des Wettbewerbs ›Zukunftsstadt‹ ein.
Der Abend im Bürgerhaus ermöglichte es, dass sich visionäre und engagierte Akteur:innen neu kennenlernen und weiter vernetzen konnten. Nur mit ihnen gemeinsam kann Nordhausen zur Region werden, in der regionale Wertschöpfung, Klimaschutz und Nachhaltigkeit groß geschrieben werden.

Anwesend waren interessierte Bürger:innen, Schüler:innen und Studierende, Bürgermeister:innen aus den Gemeinden der Region Nordhausen, die Stadtwerke, Wohnungsgesellschaft und –genossenschaft, Vereine, Energiegenossenschaften.
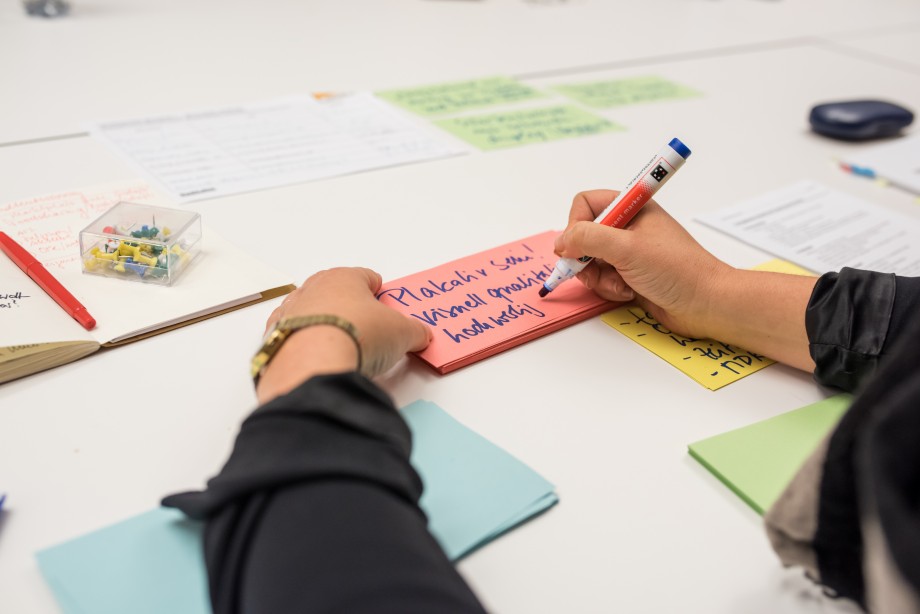
Ergebnis des ersten Tages: Viele Projekte für eine Zukunftsstadt sind in Nordhausen und im Landkreis bereits Realität. So gibt es beispielsweise Bürger:innen, die ihr Auto der Gemeinschaft zur Verfügung stellen, indem sie es stunden- oder tageweise vermietet. Andere Initiativen, wie beispielsweise die Bürgerstiftung Park Hohenrode engagieren sich schon seit Jahren für die Grundflächenentwicklung in der Region. Unternehmen wie die städtische Wohnungsgesellschaft investieren bereits in Projekte zur Gestaltung des energetischen Wandels.
Einen kurzen Input zu den Themen der drei Arbeitsgruppen ›Gemeinsam investieren‹, ›Gemeinsam Verhalten ändern‹ und ›Gemeinsam motivieren‹ gaben der Kommunikationsdesigner Prof. Steffen Schuhmann von der Kunsthochschule Berlin Weissensee, die Projektleiterin Kerstin Faber von der IBA Thüringen, der Vorsitzende des Vereins Bürgerenergie Thüringen Matthias Golle sowie Prof. Dagmar Everding vom Lehrstuhl Ökologischer Stadtumbau der Hochschule Nordhausen.
Mobil in die Zukunft
Im Januar 2016 trotzten wieder rund 70 Teilnehmer:innen dem Wintereinbruch und kamen zur zweiten Bürgerwerkstatt, um eine Stadt-Land-Mobilität für das Jahr 2030 zu entwerfen. Den fachlichen Einstieg der Veranstaltung lieferten die beiden Referenten und Experten für Mobilität Prof. Dr. Gather von der FH Erfurt und Dr. Wilde von der Goethe-Universität Frankfurt. So stellte sich unter anderem heraus, dass im Durchschnitt ein Fahrzeug zu 95% ungenutzt bleibt, ein öffentlicher Parkplatz uns alle statistisch aber 10.000 Euro pro Jahr dafür kostet. Ein CarSharing Auto ersetzt wiederum bis zu acht Privat-Pkws – und würde uns damit um 80.000 Euro pro Jahr erleichtern. Neben diesen Informationen wurden zahlreiche praktische Beispiele zu innovativen und bewegenden Initiativen und Projekten vorgestellt. In drei Arbeitsgruppen wurde anschließend weitergearbeitet.
In der ersten Arbeitsgruppe unter dem Titel ›Nordhausens Nahverkehr gesichert in die Zukunft‹ kamen die Möglichkeiten und Wege zur Sprache, den Nahverkehr in Stadt und Landkreis dauerhaft zu sichern. So wurde über einen ticketlosen ÖPNV im gesamten Landkreis und die Möglichkeiten eines Bürgerbusvereins für Nordhausen diskutiert.
Die zweite Arbeitsgruppe beschäftigte sich mit dem Thema ›Teilen statt besitzen‹, eine Überzeugung mit Nachholbedarf in Sachen Anhängerschaft. Die Wege zu einem sicheren und lebenswerten Straßenraum wurden in der dritten Arbeitsgruppe besprochen. Initiativen wie autofreie Tage, Rad- und Fußverkehrs-Apps mit Belohnungssytem und Lastenraddienstleistungen wurden vorgeschlagen.
Innovativ denken, realistisch handeln
Im Februar 2016 fand die 3. Bürgerwerkstatt, wieder mit rund 70 Teilnehmer:innen, statt. Diesmal zum anspruchsvollen Thema energetischer Stadtumbau.
Die Hochschule Nordhausen ist als Forschungs- und Bildungseinrichtung eine Quelle für Fachwissen. Prof. Dr. Dagmar Everding und Prof. Dr. Rainer Große stellten am Beginn der Veranstaltungen die aktuellen Forschungsschwerpunkte der Hochschule vor. In den Arbeitsgruppen berichteten Studierende von Semesterprojekten, in denen sie konkrete Vorschläge für den energetischen Stadtumbau in Nordhausen erarbeiteten. Christina Sager-Klaus vom Fraunhofer Institut für Bauphysik in Kassel betonte in ihrem Einstiegsvortrag die Notwendigkeit, Projekte zu initiieren, die sich langfristig eigenwirtschaftlich entwickeln können. Der Stadtumbau muss vor allem aus dem Bestand gedacht werden.
Innovativ denken und realistisch handeln war dann auch das Ergebnis der ersten Arbeitsgruppe ›Energetischer Umbau von Stadtquartieren‹. Die technischen Mittel zur Erzeugung Erneuerbarer Energien (EE) stehen bereits zur Verfügung. Vorhandene Infrastrukturen müssen auf die Nutzung von EE geprüft und umgestellt werden. Energetischer Stadtumbau bedeutet aber auch, kurze Wege zu ermöglichen. Die Einsparung von CO2 steht an erster Stelle, ebenso die soziale Verträglichkeit. Energetischer Stadtumbau muss daher immer mit einer sozial-räumlichen Qualifizierung zusammengedacht werden und darf nicht nur vor dem Hintergrund der energetischen Optimierung erfolgen.
Den Einstieg und die fachliche Begleitung der zweiten Arbeitsgruppe zum Thema ›Energielandschaft StadtLand gestalten‹ gab Prof. Dr. Doris Gstach, die die Professur Freiraumplanung und Landschaftsgestaltung an der FH Erfurt inne hat. Der Wandel im System der Energieerzeugung und Ressourcennutzung hat immer Auswirkungen auf die Landschaft gehabt. Zeugnisse historischer Produktionslandschaften werden heute größtenteils akzeptiert, sogar als natürlich ästhetisch empfunden. Dies muss auch für die aktuelle Energiewende gelten. Dabei müssen Freizeitlandschaft, Naturschutz und produktive Landschaft – ob landwirtschaftlich oder energetisch – viel stärker als eine Einheit zusammen gedacht werden. Es wurde anschließend diskutiert, wie ein Handbuch für Best Practice-Beispiele für die Region entstehen kann.
Die dritte Arbeitsgruppe ›Vom Altbau zum energetischen Traumhaus‹ beriet der Architekt Steffen Langner von ADOBE Architekten aus Erfurt. Ergebnis: Es müssen immer Individuallösungen gefunden werden, die eine nachhaltige soziale, ökonomische und ökologische Entwicklung ermöglichen. Eine Blaupause gibt es nicht. Darüber hinaus wurden konkrete Maßnahmen - wie beispielweise das Nutzen regionaler Ressourcen als nachhaltige Baustoffe für den Wohnungsbau und der Verzicht auf Verbundstoffe – diskutiert.
Startschuss für die ›Zukunftsstadt‹
Vision Nordhausen 2030: Eine Stadt und ihre Region versorgen sich selbst mit erneuerbarer Energie. Autos besitzt man nicht mehr, sondern man teilt sie sich. Parkplätze sind zu Plätzen für Parks geworden. Nordhausen isst, was in der Region, in der Stadt oder an Fassaden wächst. Neben einem Klimaschutzmanagement gibt es auch einen Ernährungsbeirat auf StadtLand-Ebene. Neubauland war gestern, in der Zukunft wird nur nachverdichtet oder umgebaut – mit klugen Raumlösungen und Mischnutzungen, aus recycelten, nachwachsenden und energiegewinnenden Rohstoffen sowie mit der neusten Speichertechnologie ausgestattet, versorgen sich die Gebäude selber. Abwasser zur Wärmegewinnung ist selbstverständlich; Trinkwasser für die Toilette ist Schnee von gestern. Der Supermarkt nebenan verkauft Lebensmittel ohne Verpackung. In einer Innovationswerkstatt entwickeln Schulen und Start-Ups Müllrecyclingprodukte. Und ganz nebenbei: Im Fitnessstudio wird nicht nur Energie verbrannt, sondern durch Strampeln produziert.
Die hier genannten Projekte sind keine Zukunftsmusik. Es gibt sie in Deutschland bereits. Was wäre aber, wenn die Stadt Nordhausen und ihre Region sie alle vereinen oder besser noch, darüber hinaus viele eigene Ideen entwickeln und umsetzen und damit selbst zum Vorreiter würde? Was wäre, wenn Nordhausen die erste ›2000 Watt Gesellschaft‹ bewusst lebt und nicht nur propagiert? Klimaschutz bedeutet nicht nur die Produktion erneuerbarer Energien, sondern auch Energieeinsparung und einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen in allen Lebensbereichen wie Mobilität, Esskultur, Baukultur, Konsum, Produktion – vom Materialursprung über die Verwendung bis zur Müllvermeidung. Das kann eine Stadt jedoch nicht alleine. Stadt und Land sind gefragt. Bewohner:innen, Vereine, Unternehmen, Schulen, öffentliche und private Institutionen!
Deshalb bewarb sich die Stadt Nordhausen gemeinsam mit der Hochschule Nordhausen im Rahmen der IBA Qualifizierungsarbeit beim Wettbewerb ›Zukunftsstadt‹ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Unter dem Titel ›Modellstadtregion für energetischen Wandel 2030+‹ schaffte es Nordhausen als eine von 51 Kommunen deutschlandweit in die erste Phase des Wettbewerbs. 2015 ging es in der ersten Phase darum, die vielen Akteur:innen und Ideen für eine umweltbewusste und ressourcenschonende Zukunftsgestaltung zu finden und erste gemeinsame Projektvorschläge zu verabreden. Dazu fanden drei Bürgerwerkstätten statt.
Die Auftakt- und Informationsveranstaltung zum Wettbewerb ›Zukunftsstadt‹ fand Im Oktober 2015 im Bürgerhaus Nordhausen statt. Der Einladungen folgten etwas 60 Akteur:innen, die sich an moderierten Tischgesprächen folgenden Fragen stellten: Was können wir nur gemeinsam tun? Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Was ist ein energetischer Stadtumbau? Heraus kamen Ideen und Vorstellungen, die in die Vorbereitung der Bürgerwerkstätten fließen:
November 2015: 1. Bürgerwerkstatt ›Gemeinsam Handeln‹
Januar 2016: 2. Bürgerwerkstatt ›Stadt-Land-Mobilität‹
Februar 2016: 3. Bürgerwerkstatt ›Energetischer Stadtumbau‹
März 2016: Abschlussveranstaltung und Präsentation der Ergebnisse
IBA Fachbeirat empfiehlt Kandidatenstatus für die Klimaregion Nordhausen
Der IBA Fachbeirat hat am 30. September 2014 empfohlen, der Klimaregion Nordhausen den Status eines IBA Kandidaten zu verleihen.
Momentan keine Termine
Landkreis Nordhausen
Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, Thüringer Richtlinie zur Förderung von Projekten und Maßnahmen der Regionalentwicklung und zur Gestaltung der Folgen des demografischen Wandels
